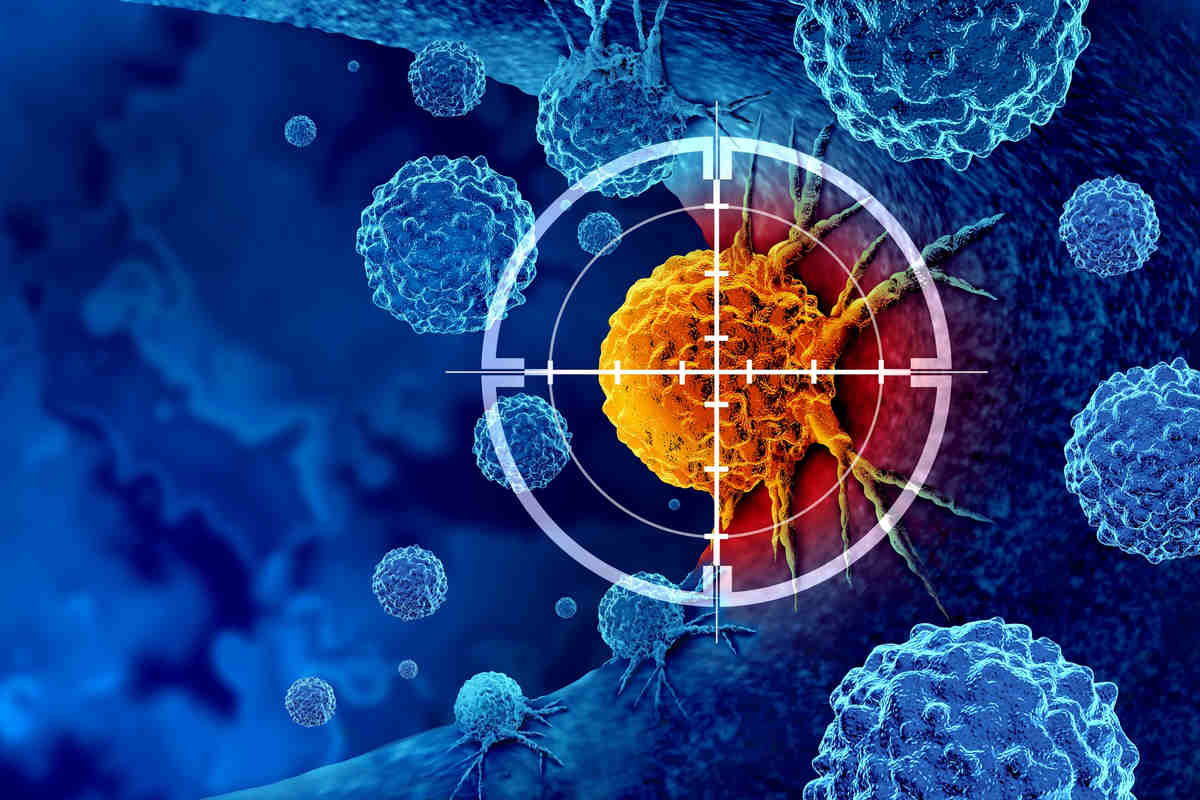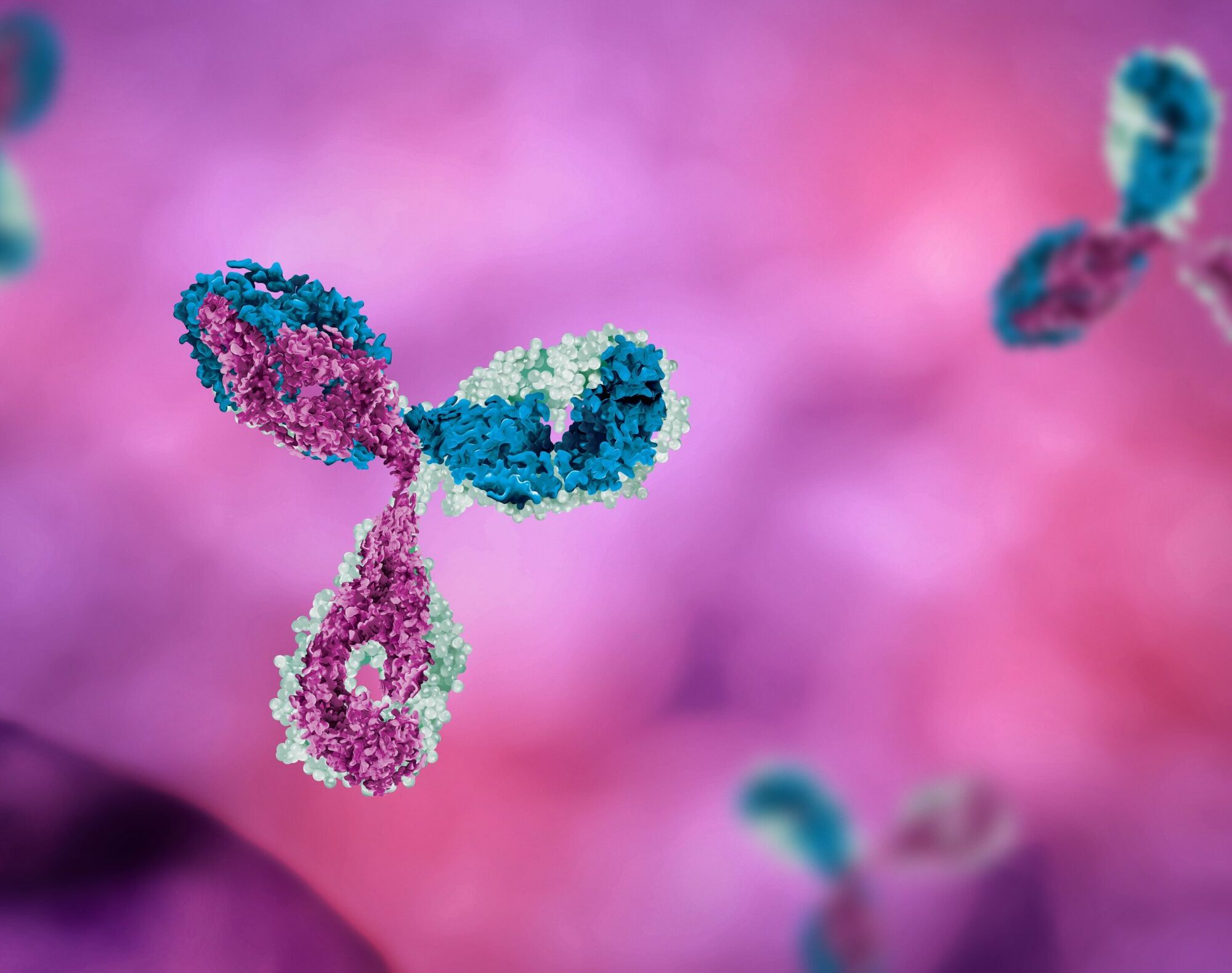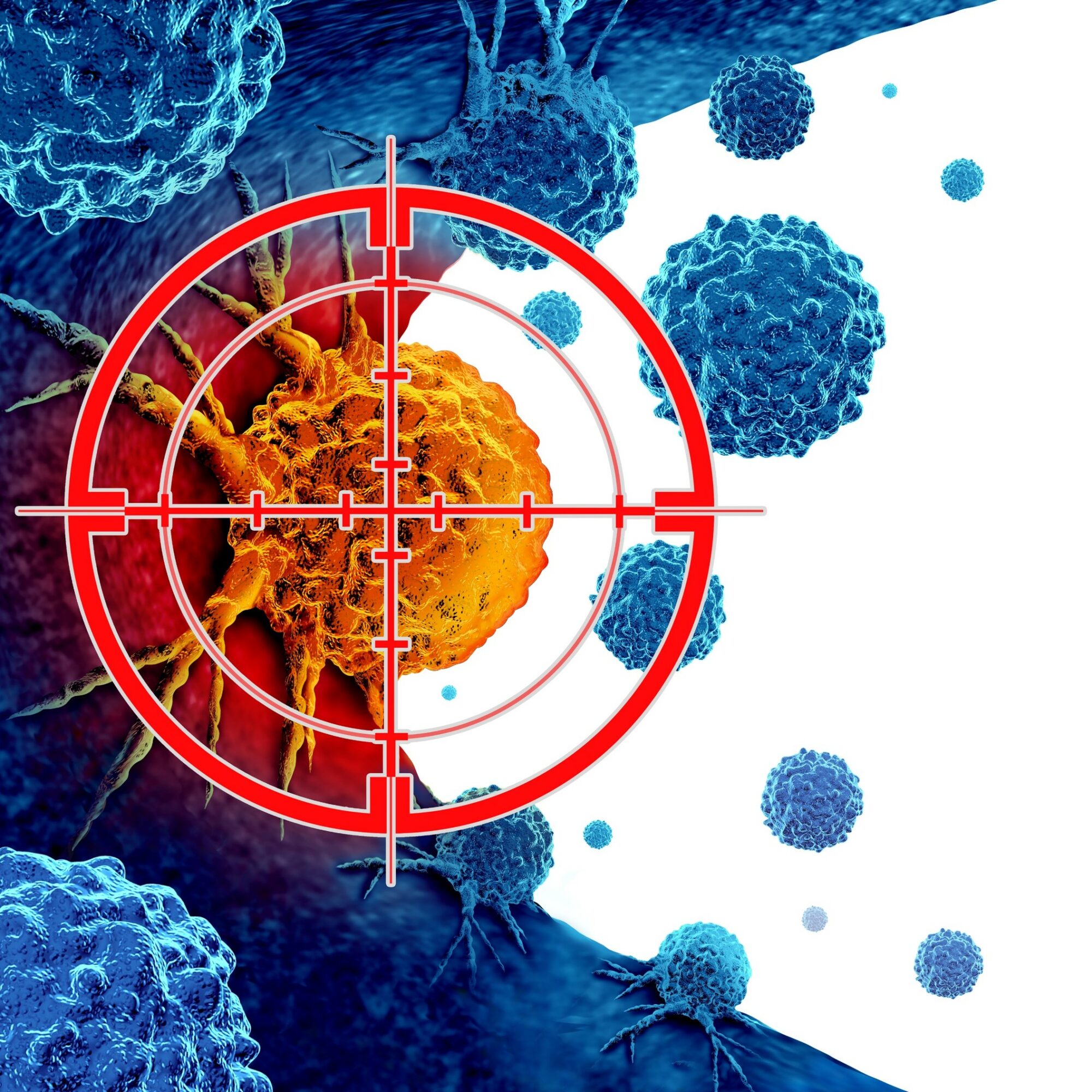Was sind PROTACs?
PROTACs sind bivalente Moleküle, die den Abbau eines bestimmten Proteins, in der Regel eines abnormen, überexprimierten Proteins in der Krebszelle, durch das eigene Proteinabbausystem der Krebszelle fördern.
Das von PROTACs adressierte Abbau-System basiert auf E3-Ligasen und dem Proteosom. Die Proteine werden dabei von E3-Ligasen mit Ubiquitin markiert, sodass sie über das Proteosom erkannt und letztendlich zu Aminosäuren abgebaut werden.
Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, das natürliche Abbausystem für den gezielten Abbau spezifischer Proteine zu nutzen. Dazu haben sie chemisch eine künstlich Nähe zwischen dem gewünschten Protein und einer E3-Ligase hergestellt. PROTAC-Moleküle enthalten zwei Anker, die auf das Protein von Interesse abzielen, sowie eine E3-Ligase und einen Linker, der beide Anker miteinander verbindet. Die Bindung der beiden Anker an ihre jeweiligen Ziele erzwingt eine Annäherung zwischen dem betreffenden Protein und der E3-Ligase.
In der Konsequenz kann die E3-Ligase das betreffende Protein ubiquitinieren und es damit für den Abbau durch das Proteosom markieren. In der heutigen Zeit wurden bereits verschiedene Anker für unterschiedliche Ziele und E3-Ligasen veröffentlicht und einige der erzeugten PROTACs werden bereits in klinischen Phasen mit vielversprechenden Ergebnissen getestet.
Welche Vorteile haben PROTACs bei der Krebsbehandlung im Vergleich zu small-molecule Inhibitoren?
Im Vergleich zu small-molecule Inhibitoren oder Antikörper-basierten Therapeutika weisen PROTACs in der Krebstherapie einige Vorteile auf:
Geringere Verabreichungsdosis
Die Funktionsweise von PROTACs basiert auf einem ereignisgesteuerten Mechanismus. Dieser führt dazu, dass sich PROTACS vom Komplex aus Zielprotein und E3-Ligase trennen, sobald das Zielprotein abgebaut wird. So könnten PROTACs ihre Abbauprozesse theoretisch fortsetzen und mehrere Zielproteine nacheinander binden. Dadurch ist es möglich, PROTACs in geringeren Dosen zu verabreichen als small-molecule Inhibitoren, die normalerweise an ihr Zielprotein gebunden bleiben, um dessen Funktion zu hemmen.
Verbesserter Abbau der Zielproteine
PROTACs führen zum Abbau eines gezielten Proteins, welches aus den Zellen entfernt wird, wodurch die Ansammlung von Zielproteinen beseitigt wird. Die Verwendung von niedermolekularen Inhibitoren blockiert das Zielprotein und stabilisiert dessen Proteinstruktur, was zu einer Verlängerung seiner Halbwertszeit führt. Zudem kann eine längere Hemmung der Proteinfunktion eine weitere und verstärkte Expression des Zielproteins auslösen, was durch die spezielle Funktion von PROTACs erklärt werden kann.
Verbesserte Selektivität und Spezifität
Der Abbau des gewünschten Proteins ist abhängig von der Bildung eines stabilen Komplexes aus dem gewünschten Protein, PROTAC und der E3-Ligase, der auf einer geeigneten Wechselwirkung zwischen der E3-Ligase und dem gewünschten Protein basiert. Aufgrund der Abhängigkeit der PROTAC-Funktion von der molekularen Struktur des Zielproteins und der E3-Ligase ist die Selektivität und Spezifität von PROTACs im Vergleich zu kleinen Molekülen erhöht.
Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung von PROTACs für die gezielte Krebstherapie?
Jedoch bringen PROTACs nicht nur Vorteile mit sich, denn besonders die Entwicklung von PROTACs birgt einige Herausforderungen:
- Molecular enhancements – PROTACs weisen aufgrund ihrer natürlichen Molekülmasse eine geringere Zellpermeabilität und Löslichkeit sowie eine reduzierte orale Bioverfügbarkeit auf. Zudem sind sie anfällig für metabolischen Abbau, da sie eine größeren Anzahl Stoffwechselstellen aufweisen. Daher besteht weiterhin Bedarf an einer Optimierung der pharmazeutischen Eigenschaften von PROTACs.
- Entstehung von Resistenzen gegen die PROTAC-Behandlung – Die Funktion von PROTACs ist abhängig von der Expression ihrer spezifischen E3-Ligase. Eine verminderte Expression dieser Ligasen in bestimmten Tumoren könnte zu einer Resistenz gegen die PROTAC-Behandlung führen.
- Minimierung von Off-Target Effekten – Die PROTAC-Behandlung birgt das Risiko von Off-Target-Effekten. Der Abbau und die vollständige Beseitigung des interessierenden Proteins könnten negative Auswirkungen auf weitere Proteine in der Zellumgebung haben.
- Erweiterung der Ligasen-Vielfalt für verbesserte Spezifität – Bislang findet lediglich eine geringe Anzahl von E3-Ligasen Anwendung für die PROTAC-Funktion, wobei die Anker für das gewünschte Protein häufig auf bereits bekannten Inhibitoren für diese Proteine basieren. Daher wird der Vorteil von PROTACs, auf nicht abbaubare Proteine zu zielen, noch nicht vollständig genutzt, und die Entdeckung von Ankern für nicht abbaubare Proteine muss vorangetrieben werden. Des Weiteren sind über 600 menschliche E3-Ligasen bekannt und stehen theoretisch für die Entwicklung von PROTACs zur Verfügung. Allerdings basiert die überwiegende Mehrheit der generierten PROTACs auf den beiden E3-Ligasen Cereblon und Van-Hippel-Lindau. E3-Ligasen zeigen ein ausgesprochen heterogenes Expressionsmuster in Bezug auf Gewebe, Tumortyp, Zellkompartiment und Zellzustand. Die Erzeugung von PROTACs, die E3-Ligasen mit einem spezifischen Expressionsprofil rekrutieren, erhöht daher die Spezifität von PROTACs und könnte somit einer Arzneimittelresistenz vorbeugen.
Erfahren Sie mehr über unsere Expertise im Bereich Krebstherapien in unserem Oncology Exploration Center >
PROTACs in klinischen Studien: aktueller Stand und vielversprechende Ergebnisse
Obwohl noch einige offene Herausforderungen bestehen, haben in den vergangenen Jahren mehrere PROTACs den Weg in die Klinik gefunden und werden gegenwärtig in klinischen Studien evaluiert. Bislang wurde noch keine Krebstherapie auf der Grundlage von PROTACs von den zuständigen Behörden zugelassen. PROTAC ARV-471 von Arvinas, ein gegen den Östrogenrezeptor gerichteter PROTAC zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs, ist das am weitesten entwickelte PROTAC in der klinischen Phase 3. Die Ergebnisse der klinischen Phase-2-Studien zeigten eine mediane Degradationsrate des Östrogenrezeptors von rund 69 %, was zu einer vielversprechenden klinischen Nutzenrate von 38 % und einer medianen progressionsfreien Überlebensrate von 3,5 % führte. Bei Patientinnen mit diagnostiziertem Brustkrebs mit mutiertem Östrogenrezeptor-Gen war die mediane progressionsfreie Überlebensrate mit 5,5 % signifikant höher.
Des Weiteren wurden von Arvinas positive klinische Ergebnisse für ihr PROTACs ARV-110 präsentiert, welches den Androgenrezeptor abbaut und gegenwärtig in der klinischen Phase 2 für die Behandlung von kastrationsresistentem Prostatakrebs evaluiert wird.
Auch andere Unternehmen, darunter Kymera und Nurix, präsentierten klinische Ergebnisse für ihre PROTACs (Kymera: KT333, KT413; Nurix: NX2127 und NX5948), die in verschiedenen Krebstherapien getestet wurden. Beide Unternehmen berichten von einem erfolgreichen Abbau des jeweiligen Proteins sowie einer positiven Pharmakokinetik und guter Verträglichkeit. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse der klinischen Phase 1 plant Nurix gemeinsam mit Sanofi eine klinische Studie der Phase 2 für NX2127.
PROTACs stellen einen vielversprechenden neuen Molekültyp für die Behandlung von Krebserkrankungen dar. Im Vergleich zu herkömmlichen niedermolekularen Inhibitoren weisen sie Vorteile auf, wie beispielsweise einen ereignisgesteuerten Mechanismus, die Eliminierung der Anreicherung von Zielproteinen sowie eine verbesserte Selektivität und Spezifität. Dennoch sind bestimmte Herausforderungen zu bewältigen, darunter pharmazeutische Eigenschaften, Arzneimittelresistenz und Off-Target-Effekte. Darüber hinaus ist das Potenzial von PROTACs noch nicht voll ausgeschöpft. Die weitere Entwicklung von Ankern für neue, nicht abbaubare Onkoproteine und beispielsweise tumorspezifische E3-Ligasen stellt die Grundlage für die Entwicklung tumorspezifischer PROTACs zur Bekämpfung nicht abbaubarer Onkoproteine dar. Neben den PROTACs befinden sich auch andere Abbauprodukte in der Entwicklung, die sich ebenfalls auf das Abbausystem der Krebszelle stützen. Dazu zählen beispielsweise molekulare Kleber als monovalente Abbauprodukte oder LYTACs und AUTACs als bivalente Abbauprodukte, die das lysosomale bzw. das Autophagiesystem der Zelle nutzen.
Alcimed beobachtet die rasanten Entwicklungen im Bereich neuartiger Krebstherapien mit großem Interesse und begleitet Sie gerne bei Ihren Projekten zu diesem Thema. Zögern Sie nicht, unser Team zu kontaktieren.
Über die Autoren,
Volker, Great Explorer Oncology und Frederike, Consultant in Alcimeds Life Sciences Team in Deutschland